
Ganz vorne mit dabei: Anwendungsorientierte Rehaforschung
Rehakliniken helfen ihren Patientinnen und Patienten dabei, ihre Leistungsfähigkeit zu stärken oder zurückzugewinnen. Doch einige Kliniken der Deutschen Rentenversicherung gehen noch einen Schritt weiter: Sie betreiben aktiv Rehabilitationsforschung. Die Verschränkung des klinisch-medizinischen Bereichs mit der anwendungsorientierten Forschung erzeugt dabei nicht nur eine fachlich anregende Arbeitsatmosphäre. Forschungsergebnisse in Form von innovativen Therapiekonzepten und Anwendungen sorgen auch für modernste Behandlungsstandards.
Boris Schmitz ist promovierter Biologe und Sportwissenschaftler, hat im Fach Experimentelle Medizin habilitiert und ist seit 2020 leitender Wissenschaftler der Forschungsabteilung an der Rehabilitationsklinik Königsfeld. Seit mittlerweile gut acht Jahren ist die Rehaklinik der Deutschen Rentenversicherung Westfalen im Bereich der Rehabilitationsforschung unter der Leitung ihres ärztlichen Direktors Prof. Dr. Frank Mooren aktiv. In Zusammenarbeit mit dem Verein für Rehabilitationsforschung sowie der Universität Witten/Herdecke werden hier bestehende Verfahren und Anwendungen hinsichtlich ihrer Wirkung überprüft und neue Therapiekonzepte entwickelt. „Es ist wirklich eine ganz besondere Situation, dass wir Rehabilitationsforschung vor Ort in der Rehabilitationseinrichtung betreiben können. So können wir neueste medizinische Erkenntnisse direkt in die anwendungsbezogene Forschung bringen“, so Schmitz. „Dabei prüfen wir nicht nur, ob neue Anwendungen oder Therapien grundsätzlich funktionieren, sondern auch, ob sie in der Einrichtung zum Einsatz kommen können und einen echten Mehrwert für unsere Patientinnen und Patienten bieten.“

Bei Behandlungsstandards ganz vorne mit dabei
Neben anderen Forschungsthemen liegt dabei ein besonderes Augenmerk auf der Frage, wie digitale Fortschritte eingesetzt werden können, um den Langzeitnutzen einer Rehabilitation zu verbessern – insbesondere im Rahmen der Nachsorge. So sind Nachsorgeprogramme, die durch ambulante Einrichtungen erbracht werden, immer zeit- und ortsgebunden. Stehen sie im Konflikt mit beruflichen und familiären Verpflichtungen oder besteht keine gute Anbindung an den Wohnort, kann sich das negativ auf die tatsächliche Teilnahme auswirken. Die Folge ist häufig eine reduzierte Adhärenz. Aus diesem Grund habe man evaluiert, inwiefern ein individuell optimiertes, telemedizinisches Nachsorgeprogramm im Rahmen der kardialen Rehabilitation zu einer Verbesserung der körperlichen Fitness sowie Lebensqualität der Teilnehmenden führen kann.
„Die zentralen Ergebnisse waren so gut, dass wir mittlerweile an der Überführung in ein Regelkonzept arbeiten“, berichtet Boris Schmitz. Für die Umsetzung prüfe die Klinik derzeit die Möglichkeiten zur Einrichtung eines Telemonitoring-Centers. Mittels dessen könnte das ärztliche und therapeutische Personal Rehabilitandinnen und Rehabilitanden auch über den Klinikaufenthalt hinaus betreuen. Schmitz ist überzeugt: „Durch innovative Behandlungsmethoden, die hier vor Ort entwickelt werden, sind unsere Ärztinnen und Ärzte ganz vorne mit dabei, was Behandlungsstandards angeht.“
Schon die laufende Forschung wirkt sich positiv auf den Regelbetrieb aus. So kann man an der Klinik Königsfeld Patientinnen und Patienten, die an den Studien teilnehmen, teils zusätzliche diagnostische Verfahren kostenlos anbieten. Im Rahmen von Fall-Kontroll-Studien werden veränderte oder neue Therapieverfahren angewandt – in der Regel zusätzlich zur Standardtherapie.
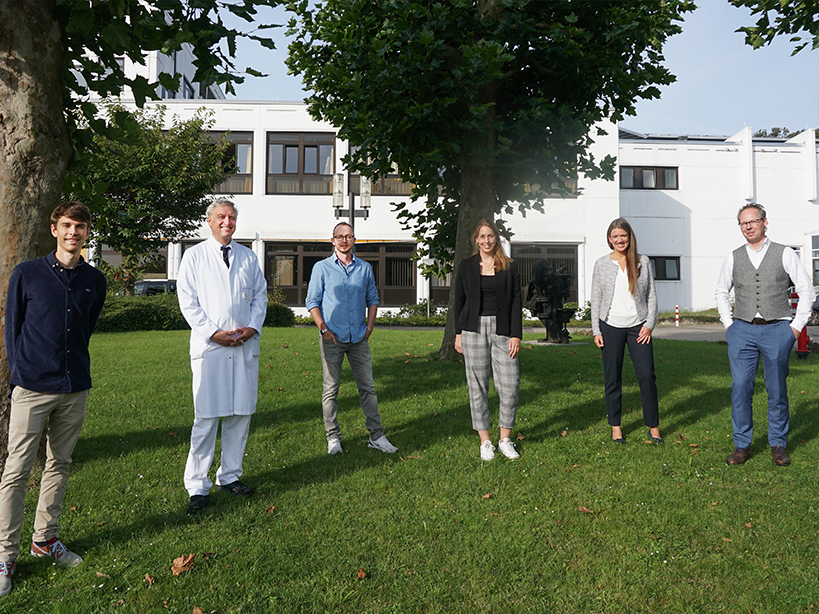
Zugleich ist an der Klinik Königsfeld der Lehrstuhl für Rehabilitationswissenschaften der Universität Witten/Herdecke angesiedelt. Prof. Dr. Frank Mooren ist dabei ärztlicher Direktor der Klinik und Lehrstuhlinhaber in Personalunion. In der Konsequenz sind er und Boris Schmitz nicht nur aktiv in die curriculare Lehre eingebunden: „Medizinstudierende absolvieren bei uns im Haus Blockseminare und Forschungspraktika, sie haben Umgang mit unseren Patienten und sammeln Erfahrungen in der Rehabilitationsmedizin“, berichtet letzterer. Die Klinik biete außerdem die Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten an, begleite auch Promotionen und Habilitationen. Als Ort des ständigen Austausches zwischen Praxis, Forschung und Lehre biete sie so ein ganz besonderes Arbeitsumfeld.
Die Klinik als Ort des ständigen Austausches
Umgekehrt ermöglicht die ständige Zusammenarbeit mit dem klinisch-ärztlichen Personal optimale Forschungsbedingungen. Zwar agieren beide Bereiche getrennt voneinander, die Wege seien allerdings kurz. „Die Ärztinnen und Ärzte unserer Klinik identifizieren im Rahmen der Anamnese Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, die für bestimmte Studien in Frage kommen. Natürlich werden sie auch bei diagnostischen Fragestellungen beteiligt“, erklärt Boris Schmitz.

„Durch innovative Behandlungsmethoden, die hier vor Ort entwickelt werden, sind unsere Ärztinnen und Ärzte ganz vorne mit dabei, was Behandlungsstandards angeht.“
Ein schöner Ort, um Arzt oder Ärztin zu sein
„Die Bedingungen, die wir hier haben, sind wirklich eine Besonderheit. Sie bieten uns die Möglichkeit, die Therapie-Response und den Langzeitnutzen der Reha im Sinne des Patientenwohls erheblich zu verbessern. Das klinisch-medizinische Personal wird dabei eng mit eingebunden, was einen ständigen fachlichen Austausch ermöglicht“, ist Boris Schmitz überzeugt und schließt daraus: „Das ist ein schöner Ort, um Arzt oder Ärztin zu sein.“
-
Ärztin / Arzt - ohne Spezialisierung
DRV Hessen Ärztliche Untersuchungsstelle Darmstadt
64293 Darmstadt- Ärztin / Arzt
- ohne Spezialisierung
- Darmstadt
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Neurologie, Psychiatrie
DRV Rheinland-Pfalz Gutachterstelle Trier
54292 Trier- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Neurologie
- Psychiatrie
- Trier
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt für Bereitschaftsdienste - ohne Spezialisierung
Rehabilitationszentrum am Sprudelhof
61231 Bad Nauheim- Ärztin / Arzt für Bereitschaftsdienste
- ohne Spezialisierung
- Bad Nauheim
-
Oberärztin / Oberarzt - Innere Medizin, Pneumologie
Klinik Norderney
26548 Norderney- Oberärztin / Oberarzt
- Innere Medizin
- Pneumologie
- Norderney
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Orthopädie, Psychiatrie, Psychosomatische Medizin
DRV Oldenburg-Bremen Standort Bremen
28209 Bremen- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Innere Medizin
- Orthopädie
- Psychiatrie
- Psychosomatische Medizin
- Bremen
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt - ohne Spezialisierung
DRV Hessen Ärztliche Untersuchungsstelle Frankfurt am Main
60439 Frankfurt am Main- Ärztin / Arzt
- ohne Spezialisierung
- Frankfurt am Main
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt zur Promotion - verschiedene Fachgebiete
Rehabilitationsklinik Göhren
18586 Göhren- Ärztin / Arzt zur Promotion
- verschiedene Fachgebiete
- Göhren
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt - verschiedene Fachgebiete
Rehabilitationsklinik Göhren
18586 Göhren- Ärztin / Arzt
- verschiedene Fachgebiete
- Göhren
- Voll-/Teilzeit
-
Oberärztin / Oberarzt - Psychiatrie, Psychosomatik, Psychosomatische Medizin, Psychotherapie
Rehabilitationsklinik Göhren
18586 Göhren- Oberärztin / Oberarzt
- Psychiatrie
- Psychosomatik
- Psychosomatische Medizin
- Psychotherapie
- Göhren
- Vollzeit
-
Ärztin / Arzt - verschiedene Fachgebiete
Mühlenbergklinik Holsteinische Schweiz
23714 Bad Malente- Ärztin / Arzt
- verschiedene Fachgebiete
- Bad Malente
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt - ohne Spezialisierung
DRV Hessen Ärztliche Untersuchungsstelle Bad Nauheim
61231 Bad Nauheim- Ärztin / Arzt
- ohne Spezialisierung
- Bad Nauheim
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt - ohne Spezialisierung
DRV Hessen Ärztliche Untersuchungsstelle Kassel
34117 Kassel- Ärztin / Arzt
- ohne Spezialisierung
- Kassel
- Voll-/Teilzeit
-
Assistenzärztin / Assistenzarzt - Diabetologie, Gastroenterologie, Innere Medizin
Klinik Rosenberg
33014 Bad Driburg- Assistenzärztin / Assistenzarzt
- Diabetologie
- Gastroenterologie
- Innere Medizin
- Bad Driburg
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Neurologie, Psychiatrie
DRV Rheinland-Pfalz Sozialmedizinischer Dienst Speyer
67346 Speyer- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Neurologie
- Psychiatrie
- Speyer
- Voll-/Teilzeit
-
Oberärztin / Oberarzt - Orthopädie
Klinik Norderney
26548 Norderney- Oberärztin / Oberarzt
- Orthopädie
- Norderney
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt - ohne Spezialisierung
DRV Hessen Ärztliche Untersuchungsstelle Künzell
36093 Künzell- Ärztin / Arzt
- ohne Spezialisierung
- Künzell
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt - Pädiatrie
Edelsteinklinik
55758 Bruchweiler- Ärztin / Arzt
- Pädiatrie
- Bruchweiler
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Physikalische Medizin
Mühlenbergklinik Holsteinische Schweiz
23714 Bad Malente- Fachärztin / Facharzt
- Innere Medizin
- Kardiologie
- Orthopädie
- Physikalische Medizin
- Bad Malente
- Voll-/Teilzeit
-
Oberärztin / Oberarzt - Physikalische Medizin
Klinik Norderney
26548 Norderney- Oberärztin / Oberarzt
- Physikalische Medizin
- Norderney
- Voll-/Teilzeit
-
Oberärztin / Oberarzt - Hämatologie, Onkologie
Klinik Sonnenblick
35043 Marburg- Oberärztin / Oberarzt
- Hämatologie
- Onkologie
- Marburg
- Vollzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Innere Medizin
Klinik Teutoburger Wald
49214 Bad Rothenfelde- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Innere Medizin
- Bad Rothenfelde
- Voll-/Teilzeit
-
Oberärztin / Oberarzt - Psychiatrie
Höhenklinik
95493 Bischofsgrün- Oberärztin / Oberarzt
- Psychiatrie
- Bischofsgrün
- Voll-/Teilzeit
- Befristet
-
Ärztin / Arzt - verschiedene Fachgebiete
Klinik Teutoburger Wald
49214 Bad Rothenfelde- Ärztin / Arzt
- verschiedene Fachgebiete
- Bad Rothenfelde
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Psychiatrie, Psychosomatische Medizin
DRV Westfalen - Ärztliche Begutachtungsstelle Dortmund
44137 Dortmund- Fachärztin / Facharzt
- Psychiatrie
- Psychosomatische Medizin
- Dortmund
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin, Betriebsmedizin, Sozialmedizin
DRV Rheinland-Pfalz
67346 Speyer- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Arbeitsmedizin
- Betriebsmedizin
- Sozialmedizin
- Speyer
- Voll-/Teilzeit
-
Assistenzärztin / Assistenzarzt - Orthopädie, Psychosomatik
Klinik Kurhessen
37242 Bad Sooden-Allendorf- Assistenzärztin / Assistenzarzt
- Orthopädie
- Psychosomatik
- Bad Sooden-Allendorf
- Voll-/Teilzeit
-
Assistenzärztin / Assistenzarzt - Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Physikalische Medizin
Mühlenbergklinik Holsteinische Schweiz
23714 Bad Malente- Assistenzärztin / Assistenzarzt
- Innere Medizin
- Kardiologie
- Orthopädie
- Physikalische Medizin
- Bad Malente
- Voll-/Teilzeit
-
Oberärztin / Oberarzt - Psychiatrie, Psychosomatische Medizin, Psychotherapie
Rehabilitationszentrum am Sprudelhof
61231 Bad Nauheim- Oberärztin / Oberarzt
- Psychiatrie
- Psychosomatische Medizin
- Psychotherapie
- Bad Nauheim
- Voll-/Teilzeit
-
Oberärztin / Oberarzt - Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie
Mühlenbergklinik Holsteinische Schweiz
23714 Bad Malente- Oberärztin / Oberarzt
- Innere Medizin
- Kardiologie
- Orthopädie
- Bad Malente
- Voll-/Teilzeit
-
Assistenzärztin / Assistenzarzt - Innere Medizin, Orthopädie
Eleonoren-Klinik
64678 Lindenfels-Winterkasten- Assistenzärztin / Assistenzarzt
- Innere Medizin
- Orthopädie
- Lindenfels-Winterkasten
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt - Allgemeinmedizin, Psychosomatische Medizin
Mittelrhein-Klinik
56154 Boppard- Ärztin / Arzt
- Allgemeinmedizin
- Psychosomatische Medizin
- Boppard
- Voll-/Teilzeit
-
Stationsärztin/Stationsarzt - verschiedene Fachgebiete
Montanus-Klinik Bad Schwalbach
65307 Bad Schwalbach- Stationsärztin/Stationsarzt
- verschiedene Fachgebiete
- Bad Schwalbach
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - verschiedene Fachgebiete
DRV Rheinland
40215 Düsseldorf- Fachärztin / Facharzt
- verschiedene Fachgebiete
- Düsseldorf
- Voll-/Teilzeit
-
Assistenzärztin / Assistenzarzt - Orthopädie
Fachklinik Oberstdorf
87561 Oberstdorf- Assistenzärztin / Assistenzarzt
- Orthopädie
- Oberstdorf
-
Assistenzärztin / Assistenzarzt - ohne Spezialisierung
Klinik Norderney
26548 Norderney- Assistenzärztin / Assistenzarzt
- ohne Spezialisierung
- Norderney
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt - Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Psychosomatische Medizin, Sozialmedizin, verschiedene Fachgebiete
Mühlenbergklinik Holsteinische Schweiz
23714 Bad Malente- Ärztin / Arzt
- Innere Medizin
- Kardiologie
- Orthopädie
- Psychosomatische Medizin
- Sozialmedizin
- verschiedene Fachgebiete
- Bad Malente
- Voll-/Teilzeit
- Befristet
-
Chefärztin / Chefarzt - Urologie
Sinntalklinik
97769 Bad Brückenau- Chefärztin / Chefarzt
- Urologie
- Bad Brückenau
- Vollzeit
-
Stationsärztin/Stationsarzt - Psychosomatik
Rehabilitationszentrum am Sprudelhof
61231 Bad Nauheim- Stationsärztin/Stationsarzt
- Psychosomatik
- Bad Nauheim
- Voll-/Teilzeit
-
Leitende Oberärztin / Leitender Oberarzt - Psychiatrie, Psychosomatische Medizin, Psychotherapie
Mittelrhein-Klinik
56154 Boppard- Leitende Oberärztin / Leitender Oberarzt
- Psychiatrie
- Psychosomatische Medizin
- Psychotherapie
- Boppard
- Vollzeit
-
Oberärztin / Oberarzt - Innere Medizin
Sinntalklinik
97769 Bad Brückenau- Oberärztin / Oberarzt
- Innere Medizin
- Bad Brückenau
- Vollzeit
-
Leitende Oberärztin / Leitender Oberarzt - Orthopädie, Physikalische Medizin
Rheumaklinik Bad Wildungen
34537 Bad Wildungen- Leitende Oberärztin / Leitender Oberarzt
- Orthopädie
- Physikalische Medizin
- Bad Wildungen
- Vollzeit
-
Oberärztin / Oberarzt - Psychosomatik, Psychosomatische Medizin
Klinik am Park
65307 Bad Schwalbach- Oberärztin / Oberarzt
- Psychosomatik
- Psychosomatische Medizin
- Bad Schwalbach
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Innere Medizin
Fachklinik Eußerthal
76857 Eußerthal- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Innere Medizin
- Eußerthal
- Voll-/Teilzeit
-
Oberärztin / Oberarzt - Psychiatrie, Psychosomatische Medizin, Psychotherapie
Mittelrhein-Klinik
56154 Boppard- Oberärztin / Oberarzt
- Psychiatrie
- Psychosomatische Medizin
- Psychotherapie
- Boppard
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Neurologie, Psychiatrie
DRV Rheinland-Pfalz Gutachterstelle Bad Kreuznach
55543 Bad Kreuznach- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Neurologie
- Psychiatrie
- Bad Kreuznach
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Orthopädie, Unfallchirurgie, verschiedene Fachgebiete
DRV Saarland
66111 Saarbrücken- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Arbeitsmedizin
- Chirurgie
- Innere Medizin
- Orthopädie
- Unfallchirurgie
- verschiedene Fachgebiete
- Saarbrücken
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Neurologie, Psychiatrie
DRV Rheinland-Pfalz Sozialmedizinischer Dienst Andernach
56626 Andernach- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Neurologie
- Psychiatrie
- Andernach
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Neurologie, Psychiatrie
DRV Schwaben Dienststelle Kempten
87435 Kempten- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Neurologie
- Psychiatrie
- Kempten
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Psychiatrie, Psychosomatische Medizin
DRV Westfalen - Ärztliche Begutachtungsstelle Bielefeld
33602 Bielefeld- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Innere Medizin
- Psychiatrie
- Psychosomatische Medizin
- Bielefeld
- Voll-/Teilzeit
-
Assistenzärztin / Assistenzarzt - verschiedene Fachgebiete
Klinik Königsfeld
58256 Ennepetal- Assistenzärztin / Assistenzarzt
- verschiedene Fachgebiete
- Ennepetal
- Vollzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Allgemeinmedizin, Neurologie, Psychiatrie
DRV Rheinland-Pfalz Gutachterstelle Kaiserslautern
67655 Kaiserslautern- Fachärztin / Facharzt
- Allgemeinmedizin
- Neurologie
- Psychiatrie
- Kaiserslautern
- Voll-/Teilzeit
-
Assistenzärztin / Assistenzarzt - Orthopädie, Psychosomatik
Klinik am Park
65307 Bad Schwalbach- Assistenzärztin / Assistenzarzt
- Orthopädie
- Psychosomatik
- Bad Schwalbach
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Psychiatrie, Psychosomatische Medizin, Psychotherapie
DRV Westfalen - Ärztliche Begutachtungsstelle Hagen
58095 Hagen- Fachärztin / Facharzt
- Psychiatrie
- Psychosomatische Medizin
- Psychotherapie
- Hagen
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt - ohne Spezialisierung
DRV Hessen Ärztliche Untersuchungsstelle Marburg
35043 Marburg- Ärztin / Arzt
- ohne Spezialisierung
- Marburg
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Psychiatrie, Psychotherapie
DRV Hessen Ärztliche Untersuchungsstelle Frankfurt am Main
60439 Frankfurt am Main- Fachärztin / Facharzt
- Psychiatrie
- Psychotherapie
- Frankfurt am Main
- Voll-/Teilzeit
-
Ärztin / Arzt - Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Psychosomatik, Psychosomatische Medizin
Mittelrhein-Klinik
56154 Boppard- Ärztin / Arzt
- Allgemeinmedizin
- Innere Medizin
- Psychosomatik
- Psychosomatische Medizin
- Boppard
- Voll-/Teilzeit
-
Fachärztin / Facharzt - Psychiatrie, Psychosomatik, Psychosomatische Medizin, Psychotherapie
DRV Oldenburg-Bremen Standort Oldenburg
26135 Oldenburg- Fachärztin / Facharzt
- Psychiatrie
- Psychosomatik
- Psychosomatische Medizin
- Psychotherapie
- Oldenburg
- Voll-/Teilzeit
Fotocredit: Deutsche Rentenversicherung Westfalen